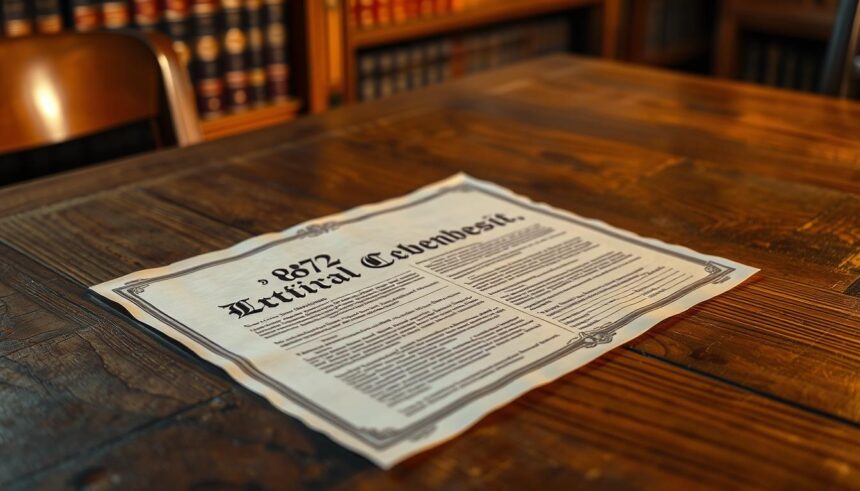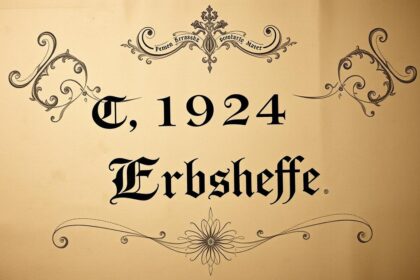Das deutsche Erbrecht definiert im § 872 Erbenbesitz eine zentrale Rechtsposition, die im Moment des Erbfalls entsteht. Die einzigartige Eigenschaft dieser Rechtsfigur liegt darin, dass der Besitz an Vermögenswerten eines Verstorbenen unmittelbar und ohne zusätzliche Übertragungsakte auf die Erben übergeht. Dieses Prinzip erleichtert die Vermögensnachfolge und gewährleistet, dass der Nachlass des Erblassers geschützt und adäquat verwaltet wird.
- Was ist Erbenbesitz nach § 872 BGB?
- Voraussetzungen für den Erbenbesitz
- Rechte des Erben im Erbenbesitz
- Pflichten des Erben im Erbenbesitz
- Erwerb des Erbenbesitzes
- Unterschiede zwischen gesetzlichem und testamentarischem Erben
- Erbenbesitz und Erbschaftsteuer
- Erbenbesitz und gemeinschaftliches Eigentum
- Beendigung des Erbenbesitzes
- Erbenbesitz und Erbstreitigkeiten
- Die Rolle des Nachlassgerichts
- Zukunftsausblick und Reformen im Erbrecht
Der Erbenbesitz ist sowohl mit Rechten als auch mit Pflichten verbunden, die eine ordnungsgemäße Nachlassverwaltung sicherstellen sollen. Es verknüpft den Gedanken des Fortbestandes des Eigentums mit der Verantwortung für die Haftung des Nachlasses. Durch dieses ausgewogene System wird gewährleistet, dass die Vermögenswerte und rechtlichen Angelegenheiten des Erblassers in vertrauenswürdige Hände übergehen.
Als Rechtssuchende Person ist es wichtig, die Implikationen des Erbenbesitzes zu verstehen, da sie wesentlich die Beziehung zum angetretenen Erbe und den Umgang mit möglichen Nachlassverbindlichkeiten definieren. In der Folge dieses Beitrags wollen wir Ihnen einen fundierten Überblick über die Materie verschaffen und umfassend aufklären, wie Sie als Erbe Ihre Rechte wahrnehmen können und welche Pflichten auf Sie zukommen.
Was ist Erbenbesitz nach § 872 BGB?
Der Erbenbesitz bildet eine zentrale Säule im deutschen Erbrecht und ist definiert als der Besitz, den eine Person erlangt, indem sie rechtlich als Erbe anerkannt wird. Dies umfasst nicht nur körperliche Gegenstände, sondern auch Rechte und Verpflichtungen, die mit dem Nachlass des Verstorbenen verbunden sind. Eine wichtige Rolle spielt dabei die automatische Übertragung des Besitzes vom Erblasser auf den Erben, die in § 857 BGB geregelt ist, ohne dass der Erbe explizit Kenntnis davon haben muss.
Besonders interessant ist, dass der Erbenbesitz gemäß § 872 BGB nicht die faktische Sachherrschaft voraussetzt. Es reicht die rechtliche Zuschreibung, dass der Erbe den Besitz „als ihm gehörend“ ansieht. Hierdurch werden sowohl rechtliche als auch praktische Probleme bezüglich der Erbfolge und des Umgangs mit dem Nachlass vermieden. Für weiterführende Informationen zu den Formen und Funktionen des Besitzes können Sie hier klicken.
Die Rechtsfähigkeit, die der Erbenbesitz mit sich bringt, gewährt dem Erben nicht nur Rechte, sondern legt ihm auch gewisse Pflichten auf. Diese betreffen die Verwaltung und den Erhalt des Nachlasses, bis eine endgültige Verteilung innerhalb der Erbengemeinschaft stattfinden kann.
Definition des Erbenbesitzes
Der Erbenbesitz ist konkret der Besitz, der von dem Verstorbenen an den Erben übergeht. Entscheidend dabei ist, dass der Besitz auf den Erben überträgt, sobald der Erbfall eintritt. Interessanterweise muss der Erbe nicht einmal eine Kenntnis vom Erbfall haben, um in den Besitz zu gelangen.
Relevante rechtliche Grundlagen
Die rechtlichen Grundlagen des Erbenbesitzes in Deutschland sind im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) festgeschrieben. § 872 BGB legt fest, was unter dem Erbenbesitz zu verstehen ist, und § 857 BGB regelt den automatischen Übergang des Besitzes von dem Erblasser auf den Erben. Diese juristischen Regelungen sorgen dafür, dass der Übergang des Besitzes reibungslos und ohne rechtliche Unsicherheiten ablaufen kann, was essentiell ist, um den Rechtsfrieden innerhalb der Erbengemeinschaft zu wahren und den Nachlass effektiv zu verwalten.
Voraussetzungen für den Erbenbesitz
Zum Verständnis der Bedingungen für den Erbenbesitz ist es essenziell, die Unterschiede zwischen gesetzlicher Erbfolge und testamentarischen Bestimmungen zu erkennen. Ein zentrales Instrument dabei ist der Erbschein, der oft als Nachweis des Erbrechts dient. Dieser Abschnitt beleuchtet die notwendigen Voraussetzungen unter Berücksichtigung der Erbengemeinschaft und der Testamentsvollstreckung.
Gesetzliche Erbfolge: Im Rahmen der gesetzlichen Erbfolge tritt der Erbe automatisch in die Rechtsnachfolge des Verstorbenen ein. Hier ist es oft so, dass der Erbschein benötigt wird, um den neuen Besitzanspruch rechtlich zu untermauern.
Testamentarische Erben: Anders verhält es sich bei testamentarischen Erben. Hier richtet sich die Erbfolge nach dem letzten Willen des Erblassers. Besonders wenn eine Testamentsvollstreckung angeordnet wurde, kann das Prozedere der Besitzübertragung komplexer werden, da der Testamentsvollstrecker die letzte Willenserklärung umsetzt.
| Gesetzliche Erbfolge | Testamentarische Erben | |
|---|---|---|
| Notwendige Dokumente | Erbschein | Testament, ggf. Erbschein |
| Verwaltung | Erbengemeinschaft verwaltet gemeinsam | Testamentsvollstrecker (falls vorgesehen) |
| Besitzübergang | Direkt nach Todesfall | Abhängig von Testament und Vollstreckung |
Es wird deutlich, dass die Art der Erbfolge entscheidenden Einfluss auf die Verfahrensweise und die Anforderungen an die Erben hat. Der Erbschein spielt dabei in vielen Konstellationen eine zentrale Rolle, sei es in der Erbengemeinschaft oder im Rahmen der Testamentsvollstreckung.
Rechte des Erben im Erbenbesitz
Die umfassenden Rechte des Erben unterstreichen das Fundament des deutschen Erbrechts, welches durch sorgfältige Nachlassverwaltung und klare Regelungen zur Vermögensnachfolge geprägt ist. Im Mittelpunkt stehen die Nutzung und die Verwertung des Erbes, wodurch Erben berechtigt sind, über die ihnen zugefallenen Vermögenswerte zu verfügen und diese zu nutzen.
Eine zentrale Rolle spielt das Pflichtteilsgesetz, das den Anspruch auf den Pflichtteil sicherstellt und somit eine gerechte Vermögensverteilung auch für diejenigen Angehörigen gewährt, die im Testament möglicherweise nicht bedacht wurden. Ein Erbe kann, insbesondere in einer Erbengemeinschaft, Informationen über den Stand der Nachlassverwaltung verlangen und hat das Recht, Entscheidungen zur Verwaltung des Erbes mitzutragen.
Durch die Nachlassverwaltung sollen die Rechte aller Beteiligten gewahrt und der Nachlass effizient verwaltet werden, damit eine gerechte Vermögensnachfolge erfolgen kann.
Unterdiesem Linkfinden Sie wichtige Fristen, die im Erbrecht beachtet werden müssen, um rechtliche Nachteile zu vermeiden.
| Recht | Kurze Beschreibung |
|---|---|
| Nutzungsrecht | Ermächtigt den Erben, den Nachlass nach eigenem Ermessen zu nutzen. |
| Verwertungsrecht | Gibt dem Erben die Möglichkeit, das Erbe zu verkaufen oder anderweitig finanziell zu verwerten. |
| Informationsrecht | Berechtigt den Erben, Auskünfte über den Nachlass und dessen Verwaltung zu erhalten. |
| Recht auf Pflichtteil | Sichert einem enterbten Angehörigen einen Mindestanteil des Nachlasses zu. |
Pflichten des Erben im Erbenbesitz
Wenn eine Person eine Erbschaft annimmt, übernimmt sie nicht nur Vermögenswerte, sondern auch wesentliche Verantwortlichkeiten. Die zwei Hauptpflichten sind die Nachlassverwaltung und die Haftung für Nachlassverbindlichkeiten. Diese Pflichten schützen die Rechte der Gläubiger und stellen sicher, dass alle finanziellen Ansprüche korrekt abgewickelt werden.
Nachlassverwaltung umfasst die Sicherung und Verwaltung aller Vermögenswerte des Erblassers. Der Erbe muss dabei gewährleisten, dass der Nachlass ordnungsgemäß verwaltet wird, was auch die Bewertung und den Verkauf von Vermögenswerten einschließen kann, um Schulden und Erbforderungen zu begleichen.
Die Erbenhaftung hingegen bezieht sich auf die Verantwortung des Erben für alle bestehenden Verbindlichkeiten des Verstorbenen. Die Schuldhaftung bedeutet konkret, dass der Erbe mit dem ererbten Vermögen für die Schulden des Erblassers haftet. Es gibt jedoch Möglichkeiten, diese Haftung zu beschränken, beispielsweise durch die Anwendung der Nachlassverwaltung oder Nachlassinsolvenz, um zu verhindern, dass private Mittel des Erben für diese Schulden verwendet werden müssen.
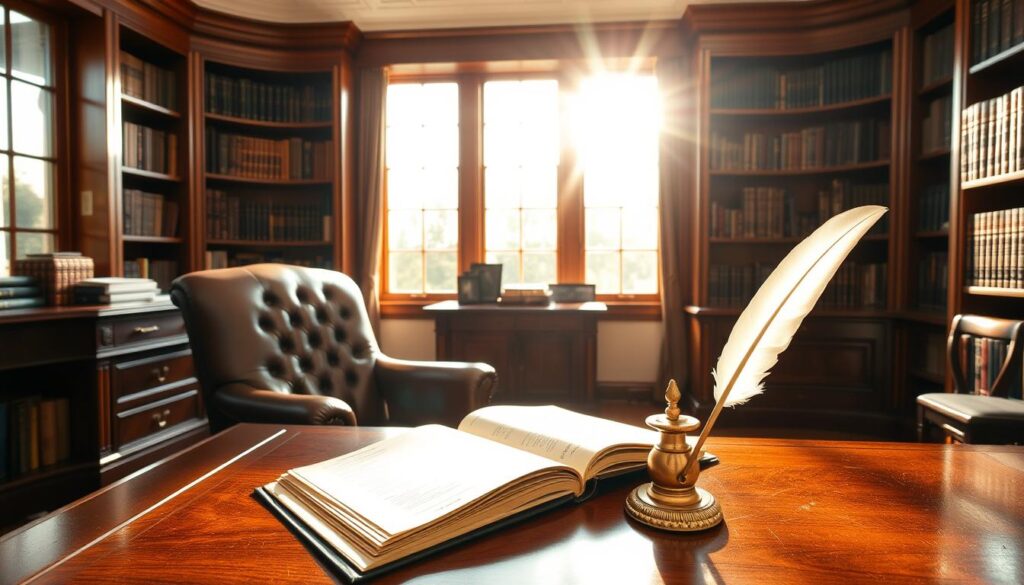
Es ist essentiell, dass Erben sich der Tragweite ihrer Aufgaben bewusst sind und gegebenenfalls rechtlichen Rat einholen, um ihre Pflichten korrekt zu erfüllen und um persönliche Haftungsrisiken zu minimieren. Die beiden Aspekte, Nachlassverwaltung und Schuldhaftung, garantieren eine transparente und gerechte Abwicklung des Erbes.
Erwerb des Erbenbesitzes
Der Erwerb des Erbenbesitzes ist ein bedeutender rechtlicher Vorgang, der bestimmt, wie Eigentum und Verpflichtungen vom Erblasser auf den Erben übergehen. Nach deutschem Recht erfolgt dies automatisch durch den Erbantritt bei Tod des Erblassers. Es ist wichtig zu verstehen, wie dieser Prozess abläuft und welche Schritte für den Erben erforderlich sind, um den Besitz wirksam anzutreten.
Übergang durch Erbantritt
Der Erbantritt geschieht automatisch und bedarf keiner aktiven Handlung des Erben. Dies bedeutet, dass die Rechte am Nachlass sowie alle damit verbundenen Pflichten unmittelbar mit dem Todesfall auf den Erben übergehen. Eine explizite Erklärung des Erben zur Übernahme des Erbes, wie etwa eine Annahmeerklärung, ist in diesem Stadium nicht erforderlich.
Notwendigkeit der Annahme des Erbes
Trotz des automatischen Übergangs durch den Erbantritt, kann die Annahme des Erbes entscheidend sein, wenn es um die rechtswirksame Regulierung des Nachlasses geht. In Situationen, in denen das Erbe ausgeschlagen oder angefochten wird, muss der Erbe eine bewusste Entscheidung zur Annahme des Erbes treffen. Durch die Annahme treten alle Rechte und Pflichten des Erbes in Kraft, und der Erbe übernimmt vollständig die Rechtsstellung des Erblassers.
Für weitere Informationen und Unterstützung beim Erwerb des Erbenbesitzes und der Nachlassübernahme besuchen Sie bitte spezialisierte Rechtsberatungsseiten. Dort finden Sie detaillierte Anleitungen und Hilfestellungen zur korrekten Abwicklung des Erbantritts und zur formalen Annahme des Erbes.
Unterschiede zwischen gesetzlichem und testamentarischem Erben
Die rechtliche Behandlung von Erbenbesitz hängt maßgeblich davon ab, ob es sich um gesetzliche Erben gemäß gesetzlicher Erbfolge handelt oder um Erben, die durch ein Testament oder einen Erbvertrag bestimmt wurden. Diese unterschiedlichen Formen der Erbfolge beeinflussen nicht nur die Rechte und Pflichten der Erben, sondern auch die Verwaltung und Verteilung des Nachlasses.
Bei der gesetzlichen Erbfolge treten die Erben in eine durch das Gesetz festgelegte Erbfolge ein, die sich primär nach der Verwandtschaftsordnung richtet. Hierbei ist das Erbe oft durch feste Quoten geregelt, die jedem Erben einen bestimmten Anteil des Nachlasses zusichern.
Im Gegensatz dazu ermöglicht ein Testament oder Erbvertrag dem Erblasser, die Verteilung seines Vermögens individuell zu regeln. Dies kann spezifische Anweisungen für einzelne Personen enthalten und somit von der gesetzlichen Regelung abweichen. Testamentarische Erben haben unter Umständen das Recht, über bestimmte Vermögenswerte frei zu verfügen, was in der gesetzlichen Erbfolge so nicht vorgesehen ist.
| Aspekt | Gesetzlicher Erbe | Testamentarischer Erbe |
|---|---|---|
| Rechte | Recht auf gesetzlich geregelten Erbteil | Kann individuelle, vom Erblasser festgelegte Rechte erhalten |
| Pflichten | Haftung für Nachlassverbindlichkeiten nach Quoten | Spezifische Pflichten, die durch Testament oder Erbvertrag auferlegt werden können |
| Verwaltung des Erbes | Oft gemeinschaftlich in der Erbengemeinschaft | Individuelle Vereinbarungen möglich, abhängig von den Bestimmungen des Erblassers |
Diese Unterscheidungen in der Art der Erbfolge haben direkte Auswirkungen darauf, wie der Erbenbesitz verwaltet und verteilt wird. Während gesetzliche Erben oft in einer Erbengemeinschaft agieren und gemeinsame Entscheidungen treffen müssen, können testamentarische Erben durch die gezielten Wünsche des Erblassers mehr Freiheiten in der Handhabung des Nachlasses haben.
Erbenbesitz und Erbschaftsteuer
Die steuerlichen Verpflichtungen, die mit dem Erbenbesitz einhergehen, stellen eine ernstzunehmende Herausforderung dar. Im Fokus steht hierbei die Erbschaftsteuer, die direkt die finanziellen Aspekte des ererbten Vermögens betrifft. Es ist entscheidend, dass Erben sich frühzeitig mit den verpflichtenden Schritten einer Steuererklärung auseinandersetzen, um Überraschungen zu vermeiden.
Das Finanzamt spielt eine zentrale Rolle im Prozess der Erbschaftsbesteuerung. Es ist die Behörde, an die die Steuererklärungen gerichtet und die notwendigen Unterlagen eingereicht werden müssen. Die Fristen für die Abgabe dieser Dokumente sind strikt einzuhalten. Versäumt ein Erbe diese, können zusätzliche Kosten durch Säumniszuschläge entstehen.
| Verwandtschaftsgrad | Freibetrag | Steuerklasse |
|---|---|---|
| Ehepartner | 500.000 € | I |
| Kinder | 400.000 € | I |
| Geschwister | 20.000 € | II |
| Nicht verwandt | 20.000 € | III |
Zur Bestimmung der konkreten Höhe der Erbschaftsteuer sind sowohl der Verwandtschaftsgrad zum Verstorbenen als auch der Wert des geerbten Vermögens ausschlaggebend. Die obige Tabelle gibt eine Übersicht über die verschiedenen Freibeträge, die je nach Steuerklasse und Verwandtschaftsgrad anwendbar sind.
Im Hinblick auf den gestiegenen Bedarf an Transparenz und rechtlicher Klarheit empfiehlt es sich, frühzeitig professionelle Beratung einzuholen. Eine umfassende Beratung hilft nicht nur bei der steueroptimierten Gestaltung der Erbschaft, sondern auch bei der rechtzeitigen und korrekten Abwicklung aller steuerlichen Pflichten gegenüber dem Finanzamt.
Erbenbesitz und gemeinschaftliches Eigentum
Wenn mehrere Personen eine Erbschaft gemeinsam antreten, entsteht eine sogenannte Erbengemeinschaft. Hierbei wird das Vermögen des Verstorbenen zum Gemeinschaftseigentum der Miterben. Diese Konstellation bringt bestimmte Regelungen und Pflichten mit sich, die alle Beteiligten verstehen und respektieren sollten.
Innerhalb einer Erbengemeinschaft hat jeder Miterbe nicht nur Anspruch auf seinen individuellen Anteil, sondern ist auch an der Verwaltung des Gemeinschaftseigentums beteiligt. Dies erfordert ein hohes Maß an Kooperation und Abstimmung unter den Erben, um Entscheidungen einvernehmlich zu treffen.

Entscheidungen betreffend das gemeinsame Vermögen bedürfen in der Regel der Zustimmung aller Erbengemeinschaftsmitglieder, es sei denn, es gibt anderslautende Regelungen in einem Erbvertrag oder Testament. Differenzen unter den Miterben, die nicht intern gelöst werden können, führen oft zu gerichtlichen Auseinandersetzungen. Solche Konflikte können die Verwaltung des Erbes erheblich verzögern und zusätzliche Kosten verursachen.
Zur effektiven Verwaltung und Nutzung des Erbes ist es wichtig, dass sich alle Miterben über ihre Rollen und Pflichten im Klaren sind und aktiv an der Gestaltung der Erbengemeinschaft teilnehmen. Dadurch kann das Vermögen der Erbengemeinschaft geschützt und für alle Beteiligten ein gerechter Ausgleich geschaffen werden.
Beendigung des Erbenbesitzes
Die Beendigung des Erbenbesitzes stellt einen wichtigen Wendepunkt in der Verwaltung und Verteilung des Nachlasses dar. Es gibt verschiedene Gründe, warum der Besitz eines Erben enden kann, die von der rechtlichen Notwendigkeit bis hin zu persönlichen Entscheidungen der Erben reichen.
Ursachen für die Beendigung
Grundlegend für die Beendigung des Erbenbesitzes kann die Nachlassaufteilung sein, wenn Erben sich entschließen, den Nachlass des Verstorbenen aufzuteilen. Dies geschieht oft, um klar definierte Anteile zu schaffen und Rechtsunsicherheiten innerhalb der Erbengemeinschaft abzubauen. Zudem kann die Beendigung auch durch die Erfüllung der letzten Willensbekundungen des Erblassers ausgelöst werden, insbesondere wenn spezielle Anweisungen zur Aufteilung oder Nutzung des Nachlasses vorliegen.
Möglichkeiten der Übertragung
Die Übertragung des Erbes kann durch verschiedene rechtliche Transaktionen erfolgen, darunter die Eigentumsübertragung und der Verkauf von Erbanteilen. Diese können sowohl zwischen den Erben als auch zwischen einem Erben und einem externen Dritten stattfinden. Die Eigentumsübertragung erfolgt meist über rechtlich bindende Verträge, die sowohl die Interessen des Verkäufers als auch des Erwerbers wahren. Der Verkauf von Erbanteilen kann eine praktische Lösung für Erben darstellen, die ihre erbrechtlichen Ansprüche monetarisieren möchten, ohne dabei den familiären Frieden zu gefährden.
Erbenbesitz und Erbstreitigkeiten
In der Abwicklung des Erbes treten nicht selten Erbenkonflikte auf, die sowohl emotionale als auch rechtliche Herausforderungen darstellen. Gemäß der Erfahrung sind Differenzen in der Nachlassverteilung und Pflichtteilsansprüche häufige Zündstoffe, die intensive Auseinandersetzungen zwischen den Beteiligten auslösen können.
Zur Vermeidung dieser Erbstreitigkeiten sollte von Beginn an eine klare und faire Kommunikation zwischen den Erben gefördert werden. Hierbei ist eine rechtlich fundierte Begleitung unerlässlich, um Missverständnisse klären und gerechte Lösungen finden zu können.
| Streitursache | Möglichkeiten der Konfliktlösung |
|---|---|
| Uneinigkeit über die Nachlassverteilung | Vermittlung durch neutrale Drittpersonen, Mediationsverfahren |
| Geltendmachung von Pflichtteilsansprüchen | Gerichtliche Klärung, außergerichtliche Einigungen |
| Fragen der Wertzuweisung einzelner Nachlassgegenstände | Gutachten durch anerkannte Sachverständige, Einigungsgespräche |
Eine bedeutende Rolle spielen außerdem transparente Verfahren zur Einsicht in die Nachbarschaftsunterlagen. Dadurch erhalten alle Erben Einsicht in relevante Dokumente, was das Verständnis für die Entscheidungsprozesse verbessert und Streitigkeiten präventiv entgegenwirkt.
Um die juristische Komplexität der Situation gerecht zu werden, ist es ratsam, sich frühzeitig von einem Fachanwalt beraten zu lassen. Diese Experten verstehen es, sowohl die emotionalen Bedürfnisse der Erben als auch die rechtlichen Anforderungen in Einklang zu bringen, um so eine zufriedenstellende Lösung für alle Beteiligten zu erreichen.
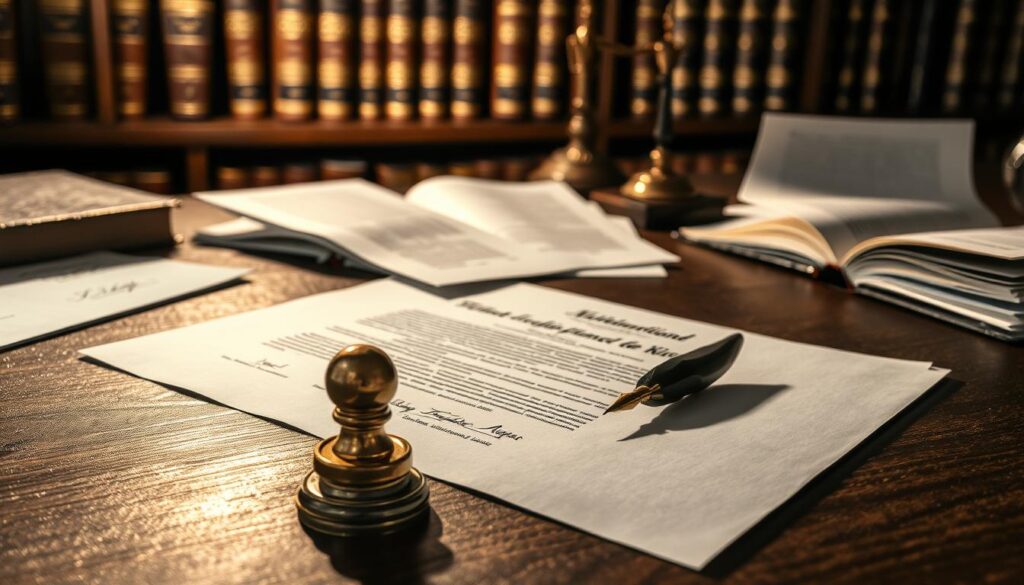
Diese Herangehensweise sichert nicht nur eine gerechte Verteilung des Nachlasses, sondern verhindert auch langwierige juristische Auseinandersetzungen, die oft mit hohen Kosten und emotionalen Belastungen verbunden sind.
Die Rolle des Nachlassgerichts
Das Nachlassgericht spielt eine entscheidende Rolle im Rahmen der Nachlasssicherung und bei erbrechtlichen Streitigkeiten. Es ist die erste Anlaufstelle für Erben und andere Beteiligte, um rechtliche Fragen zum Nachlass effektiv zu klären.
Zuständigkeiten des Nachlassgerichts konzentrieren sich auf eine Vielzahl wesentlicher Aufgaben. Es ist verantwortlich für die Erteilung von Erbscheinen, die eine formelle Anerkennung der Erbberechtigung darstellen. Weiterhin übernimmt das Nachlassgericht die Anordnung von Testamentsvollstreckungen sowie die Einsetzung von Nachlasspflegern, die den Nachlass bis zur endgültigen Verteilung verwalten.
Darüber hinaus ist das Nachlassgericht bei erbrechtlichen Streitigkeiten gefordert, vermittelnd einzugreifen und eine friedliche Lösung zu fördern. Diese Eingriffe können unerlässlich werden, wenn Uneinigkeit unter den Erben herrscht oder Ansprüche Dritter geltend gemacht werden.
Unterstützungsmaßnahmen bei Erbenfragen umfassen nicht nur die rechtliche Klärung, sondern auch die praktische Unterstützung der Erben. Das Gericht hilft bei der Interpretation von Testamenten, klärt Pflichtteilansprüche und unterstützt bei der Aufteilung des Nachlasses.
| Aufgabe | Zuständigkeit |
|---|---|
| Erteilung von Erbscheinen | Nachlassgericht |
| Anordnung von Testamentsvollstreckungen | Nachlassgericht |
| Verwaltung des Nachlasses | Nachlasspfleger |
| Vermittlung bei erbrechtlichen Streitigkeiten | Nachlassgericht |
Durch diese vielfältigen Zuständigkeiten sichert das Nachlassgericht die Ordnung im Erbfall und stellt sicher, dass alle Beteiligten ihre rechtmäßigen Ansprüche geltend machen können. Damit trägt es wesentlich zur Nachlasssicherung und zur Vermeidung von erbrechtlichen Streitigkeiten bei.
Zukunftsausblick und Reformen im Erbrecht
Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und gesellschaftlichen Wandels steht das Erbrecht vor neuen Herausforderungen und Veränderungen. Die steigende Relevanz des digitalen Nachlasses wirft Fragen nach der adäquaten Behandlung und Vererbbarkeit digitaler Inhalte auf. Die Notwendigkeit einer umfassenden Erbrechtsreform wird durch diese Entwicklungen verstärkt und zielt darauf ab, das geltende Recht an die modernen Bedingungen anzupassen.
Aktuelle Entwicklungen und Trends
Der Begriff „Digitales Erbe“ gewinnt zunehmend an Bedeutung, da immer mehr Menschen digitale Vermögenswerte wie Online-Konten und soziale Medien hinterlassen. Darüber hinaus üben demografische Verschiebungen und das veränderte Familienbild Einfluss auf das Erbrecht aus, sodass Änderungen in der Erbfolge erforderlich werden könnten. Eine Reform wird erörtert, um den Wandel der Gesellschaft widerzuspiegeln und das Recht zukunftsfähig zu gestalten.
Mögliche Änderungen des § 872 BGB
Erbfolgeänderungen sind Teil der Diskussionen, um das Erbrecht den Bedürfnissen der heutigen Gesellschaft anzupassen. Mögliche Anpassungen im § 872 BGB könnten auf eine klarere Regelung der Besitzverhältnisse abzielen. Die Notwendigkeit, Regelungen für das digitale Vermögen in das Erbschaftsrecht zu integrieren, wird immer deutlicher. Reformbestrebungen nehmen diese Aspekte auf, um Demokratie im Erbrecht zu verwirklichen und jeder Person gerecht zu werden.