Das Völkerstrafrecht stellt einen zentralen Bestandteil der internationalen Rechtsordnung dar und befasst sich mit den schwersten Verbrechen, die die internationale Gemeinschaft als Ganzes betreffen. Es bildet die rechtliche Grundlage für die Verfolgung von Völkermord, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und dem Verbrechen der Aggression. In diesem Artikel erfahren Sie, wie dieses Rechtsgebiet entstanden ist, welche Kernverbrechen es umfasst und wie es heute angewendet wird.
Definition und historische Entwicklung des Völkerstrafrechts
Das Völkerstrafrecht findet bei schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen wie Völkermord, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Verbrechen der Aggression Anwendung. Diese Verbrechen betreffen meist nicht einen einzelnen Staat, sondern die Weltgemeinschaft als Ganzes. Die Strafverfolgung nach dem Völkerstrafrecht kann – je nach Fall – vor einem nationalen oder auch internationalen Gericht wie dem Internationalen Strafgerichtshof erfolgen.
Historische Meilensteine
Die Entwicklung des Völkerstrafrechts ist eng mit den Schrecken des 20. Jahrhunderts verbunden. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden mit den Nürnberger Prozessen (1945-1949) erstmals hochrangige Vertreter eines Staates für Verbrechen gegen den Frieden, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zur Verantwortung gezogen. Diese Prozesse legten den Grundstein für das moderne Völkerstrafrecht.
In den 1990er Jahren wurden als Reaktion auf die Konflikte im ehemaligen Jugoslawien und in Ruanda zwei Ad-hoc-Tribunale eingerichtet. Diese Sondertribunale trugen maßgeblich zur Weiterentwicklung des Völkerstrafrechts bei und bereiteten den Weg für die Errichtung des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH).
Rechtliche Grundlagen
Das Völkerstrafrecht basiert auf verschiedenen Rechtsquellen, darunter:
- Internationale Verträge und Konventionen (z.B. die Genfer Konventionen)
- Das Römische Statut des Internationalen Strafgerichtshofs
- Völkergewohnheitsrecht
- Allgemeine Rechtsgrundsätze
- Nationale Gesetzgebung (in Deutschland: Völkerstrafgesetzbuch)
Diese Rechtsquellen bilden zusammen ein komplexes System, das die Verfolgung schwerster internationaler Verbrechen ermöglicht.

Vertiefen Sie Ihr Wissen zum Völkerstrafrecht
Erhalten Sie unseren kostenlosen Newsletter mit aktuellen Entwicklungen und Fallanalysen aus dem Bereich des internationalen Strafrechts.
Die Kernverbrechen des Völkerstrafrechts
Das Völkerstrafrecht konzentriert sich auf vier Kernverbrechen, die aufgrund ihrer Schwere und ihres Ausmaßes die internationale Gemeinschaft als Ganzes betreffen. Diese Verbrechen unterliegen dem Weltrechtsprinzip, was bedeutet, dass sie unabhängig vom Tatort und der Nationalität der Täter oder Opfer verfolgt werden können.
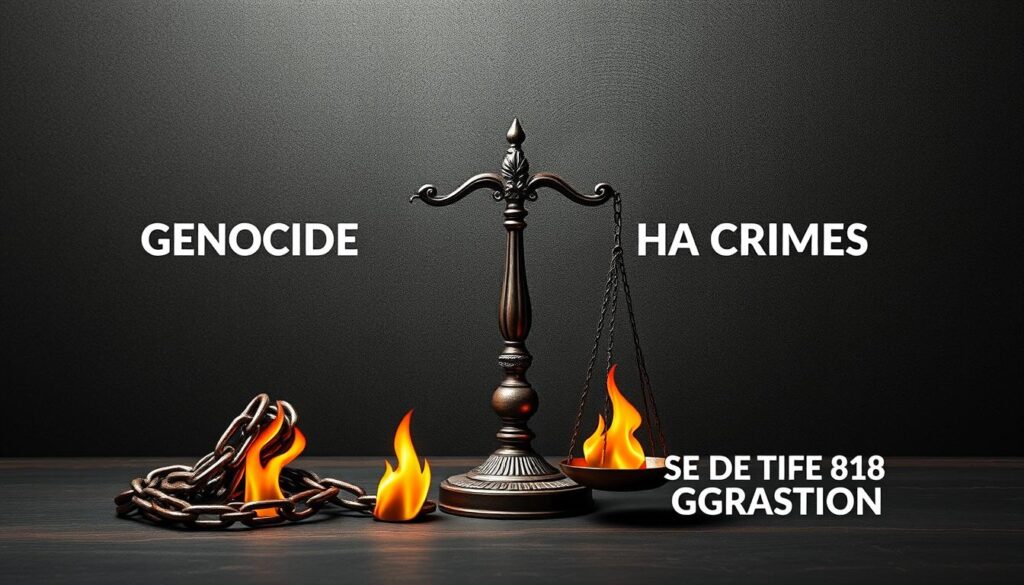
Völkermord
Völkermord ist definiert als Handlung, die in der Absicht begangen wird, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe ganz oder teilweise zu zerstören. Zum Tatbestand des Völkermordes zählen:
- Das Töten von Mitgliedern der Gruppe
- Das Zufügen von schweren körperlichen oder seelischen Schäden an Mitgliedern der Gruppe
- Die vorsätzliche Auferlegung von Lebensbedingungen, die geeignet sind, die körperliche Zerstörung der Gruppe ganz oder teilweise herbeizuführen
- Die Verhängung von Maßnahmen, die Geburten innerhalb der Gruppe verhindern sollen
- Die gewaltsame Überführung von Kindern der Gruppe in eine andere Gruppe
Zu den anerkannten Völkermorden zählen unter anderem der Völkermord an den Ovaherero und Nama in Namibia (1904-1908), der Völkermord an den Armeniern im Osmanischen Reich (1915-1916), der Holocaust (1941-1945) und der Völkermord in Ruanda (1994).
Verbrechen gegen die Menschlichkeit
Verbrechen gegen die Menschlichkeit sind schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen, die im Rahmen eines ausgedehnten oder systematischen Angriffs gegen die Zivilbevölkerung begangen werden. Dazu zählen:
- Mord
- Ausrottung
- Versklavung
- Deportation oder zwangsweise Überführung der Bevölkerung
- Freiheitsentzug unter Verstoß gegen grundlegende Regeln des Völkerrechts
- Folter
- Sexuelle Gewalt
- Verfolgung aus politischen, rassischen, nationalen, ethnischen, kulturellen, religiösen oder geschlechtsspezifischen Gründen
- Verschwindenlassen von Personen
- Apartheid
Kriegsverbrechen
Kriegsverbrechen sind schwere Verstöße gegen das in bewaffneten Konflikten anwendbare humanitäre Völkerrecht. Sie können sowohl in internationalen als auch in nicht-internationalen bewaffneten Konflikten begangen werden. Zu den Kriegsverbrechen zählen unter anderem:
- Vorsätzliche Angriffe auf die Zivilbevölkerung
- Einsatz verbotener Waffen oder Kampfmethoden
- Folter oder unmenschliche Behandlung
- Geiselnahme
- Plünderung
- Sexuelle Gewalt
- Einsatz von Kindersoldaten
Verbrechen der Aggression
Das Verbrechen der Aggression ist definiert als die Planung, Vorbereitung, Einleitung oder Durchführung einer Angriffshandlung durch eine Person, die tatsächlich in der Lage ist, das politische oder militärische Handeln eines Staates zu kontrollieren oder zu lenken. Die Angriffshandlung muss ihrer Art, ihrer Schwere und ihrem Umfang nach eine offenkundige Verletzung der Charta der Vereinten Nationen darstellen.
Dieses Verbrechen wurde erst 2010 durch eine Änderung des Römischen Statuts definiert und 2018 in die Zuständigkeit des Internationalen Strafgerichtshofs aufgenommen.
„Das Völkerstrafrecht stellt sicher, dass die schwersten Verbrechen, die die internationale Gemeinschaft als Ganzes berühren, nicht ungestraft bleiben.“
Rechtliche Grundlagen und Institutionen
Die Durchsetzung des Völkerstrafrechts erfolgt durch ein komplexes System nationaler und internationaler Institutionen. Im Zentrum steht dabei das Römische Statut des Internationalen Strafgerichtshofs, das die rechtliche Grundlage für die Verfolgung der Kernverbrechen bildet.

Das Römische Statut und der Internationale Strafgerichtshof
Das Römische Statut wurde 1998 verabschiedet und trat 2002 in Kraft. Es bildet die rechtliche Grundlage für den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) mit Sitz in Den Haag. Der IStGH ist ein ständiges internationales Strafgericht, das für die Verfolgung der Kernverbrechen des Völkerstrafrechts zuständig ist.
Wichtige Merkmale des IStGH sind:
- Komplementaritätsprinzip: Der IStGH wird nur tätig, wenn nationale Gerichte nicht willens oder in der Lage sind, die Verbrechen selbst zu verfolgen
- Unabhängigkeit: Der IStGH ist keine UN-Organisation, sondern eine eigenständige internationale Organisation
- Zuständigkeit: Der IStGH ist nur für Verbrechen zuständig, die nach Inkrafttreten des Statuts begangen wurden
- Mitgliedschaft: Derzeit haben 123 Staaten das Römische Statut ratifiziert (Stand 2023)
Nationale Gesetzgebung: Das deutsche Völkerstrafgesetzbuch
Deutschland hat mit dem Völkerstrafgesetzbuch (VStGB) von 2002 ein eigenes Gesetz zur Verfolgung von Völkerrechtsverbrechen geschaffen. Das VStGB setzt die Bestimmungen des Römischen Statuts in nationales Recht um und ermöglicht die Verfolgung von Völkerrechtsverbrechen vor deutschen Gerichten.
Besonderheiten des deutschen Völkerstrafgesetzbuchs:
- Weltrechtsprinzip: Deutschland kann Völkerrechtsverbrechen unabhängig vom Tatort und der Nationalität der Täter oder Opfer verfolgen
- Keine Verjährung: Völkerrechtsverbrechen verjähren nicht
- Vorgesetztenverantwortlichkeit: Auch Vorgesetzte können für Verbrechen ihrer Untergebenen zur Verantwortung gezogen werden
- Umschaltnorm: § 2 VStGB verweist auf den Allgemeinen Teil des StGB, soweit das VStGB keine Sonderregelungen enthält
Völkerstrafrecht im Detail verstehen
Laden Sie unseren kostenlosen Leitfaden herunter, der die wichtigsten Konzepte und Fälle des Völkerstrafrechts anschaulich erklärt.
Durchsetzungsmechanismen und Verfahren
Die Durchsetzung des Völkerstrafrechts erfolgt auf verschiedenen Ebenen und durch unterschiedliche Mechanismen. Neben dem Internationalen Strafgerichtshof spielen auch nationale Gerichte, Ad-hoc-Tribunale und hybride Gerichte eine wichtige Rolle.

Der Grundsatz der Komplementarität
Ein zentrales Prinzip des Völkerstrafrechts ist der Grundsatz der Komplementarität. Dieser besagt, dass die primäre Verantwortung für die Verfolgung von Völkerrechtsverbrechen bei den nationalen Gerichten liegt. Der Internationale Strafgerichtshof wird nur tätig, wenn nationale Gerichte nicht willens oder in der Lage sind, die Verbrechen selbst zu verfolgen.
Dieser Grundsatz soll die Souveränität der Staaten respektieren und gleichzeitig sicherstellen, dass schwere Verbrechen nicht ungestraft bleiben.
Verfahren vor dem Internationalen Strafgerichtshof
Das Verfahren vor dem IStGH gliedert sich in mehrere Phasen:
- Vorprüfungsverfahren: Die Anklagebehörde prüft, ob hinreichende Anhaltspunkte für die Begehung von Verbrechen vorliegen
- Ermittlungsverfahren: Bei ausreichenden Anhaltspunkten leitet die Anklagebehörde förmliche Ermittlungen ein
- Vorverfahren: Eine Vorverfahrenskammer prüft, ob hinreichende Gründe für die Eröffnung eines Hauptverfahrens vorliegen
- Hauptverfahren: Das eigentliche Strafverfahren vor einer Hauptverfahrenskammer
- Rechtsmittelverfahren: Gegen Entscheidungen des IStGH können Rechtsmittel eingelegt werden
Nationale Strafverfolgung nach dem Weltrechtsprinzip
Das Weltrechtsprinzip ermöglicht es Staaten, Völkerrechtsverbrechen unabhängig vom Tatort und der Nationalität der Täter oder Opfer zu verfolgen. Dieses Prinzip basiert auf der Idee, dass bestimmte Verbrechen so schwerwiegend sind, dass sie die internationale Gemeinschaft als Ganzes betreffen.
In Deutschland wurden bereits mehrere Verfahren nach dem Weltrechtsprinzip durchgeführt, unter anderem gegen Verantwortliche für Verbrechen in Syrien und im Irak.
Wie wird ein Fall vor den Internationalen Strafgerichtshof gebracht?
Ein Fall kann auf drei Wegen vor den IStGH gebracht werden:
- Durch einen Vertragsstaat des Römischen Statuts
- Durch den UN-Sicherheitsrat
- Durch den Ankläger des IStGH aus eigener Initiative (proprio motu)
In allen Fällen muss der Ankläger zunächst prüfen, ob hinreichende Anhaltspunkte für die Begehung von Verbrechen vorliegen, bevor förmliche Ermittlungen eingeleitet werden können.
Aktuelle Herausforderungen und Kontroversen
Trotz bedeutender Fortschritte steht das Völkerstrafrecht vor zahlreichen Herausforderungen. Die Durchsetzung bleibt schwierig, und politische Faktoren beeinflussen oft die Strafverfolgung.

Politische und praktische Herausforderungen
Das Völkerstrafrecht steht vor verschiedenen politischen und praktischen Herausforderungen:
- Fehlende Universalität: Wichtige Staaten wie die USA, Russland und China haben das Römische Statut nicht ratifiziert
- Selektivität: Kritiker werfen dem IStGH vor, sich überwiegend auf Fälle in Afrika zu konzentrieren
- Fehlende Durchsetzungsmechanismen: Der IStGH verfügt über keine eigenen Polizeikräfte und ist auf die Kooperation der Staaten angewiesen
- Immunität: Trotz der Regelungen im Römischen Statut bleibt die Immunität von Staatsoberhäuptern ein umstrittenes Thema
Weitere Herausforderungen umfassen:
- Lange Verfahrensdauer: Völkerstrafrechtliche Verfahren sind oft komplex und dauern mehrere Jahre
- Hohe Kosten: Die Verfolgung von Völkerrechtsverbrechen ist mit erheblichen Kosten verbunden
- Beweisschwierigkeiten: Die Beweiserhebung in Konfliktgebieten ist oft schwierig und gefährlich
- Opferbeteiligung: Die angemessene Beteiligung von Opfern an den Verfahren bleibt eine Herausforderung
Bedeutende Fälle und ihre Auswirkungen
Einige bedeutende Fälle haben das Völkerstrafrecht maßgeblich geprägt:
Der Fall Thomas Lubanga
Thomas Lubanga war der erste Angeklagte, der vom IStGH verurteilt wurde. Er wurde 2012 wegen der Rekrutierung und des Einsatzes von Kindersoldaten in der Demokratischen Republik Kongo zu 14 Jahren Haft verurteilt.
Der Fall Al-Bashir
Gegen den ehemaligen sudanesischen Präsidenten Omar al-Bashir erließ der IStGH 2009 einen Haftbefehl wegen Völkermords, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen in Darfur. Trotz des Haftbefehls konnte er lange Zeit unbehelligt reisen.
Der FDLR-Fall in Deutschland
In Deutschland wurden 2015 zwei Führungsmitglieder der ruandischen Miliz FDLR wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in der Demokratischen Republik Kongo verurteilt. Es war das erste Verfahren nach dem deutschen Völkerstrafgesetzbuch.
Zukunftsperspektiven
Trotz aller Herausforderungen entwickelt sich das Völkerstrafrecht stetig weiter. Aktuelle Entwicklungen umfassen:
- Stärkere Fokussierung auf sexuelle und geschlechtsbezogene Gewalt
- Ausweitung der Zuständigkeit auf das Verbrechen der Aggression
- Verstärkte nationale Strafverfolgung nach dem Weltrechtsprinzip
- Entwicklung hybrider Gerichte, die nationale und internationale Elemente kombinieren
- Stärkere Einbeziehung von Opfern in die Verfahren
Bleiben Sie informiert über aktuelle Entwicklungen
Melden Sie sich für unseren Newsletter an und erhalten Sie regelmäßige Updates zu aktuellen Fällen und Entwicklungen im Völkerstrafrecht.
Fazit: Die Bedeutung des Völkerstrafrechts
Das Völkerstrafrecht hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einem wichtigen Instrument entwickelt, um die schwersten Verbrechen zu verfolgen und zu bestrafen. Es trägt dazu bei, die Straflosigkeit zu bekämpfen und den Opfern Gerechtigkeit widerfahren zu lassen.

Trotz aller Herausforderungen und Kontroversen hat das Völkerstrafrecht bereits bedeutende Erfolge erzielt. Es hat dazu beigetragen, dass schwere Menschenrechtsverletzungen nicht mehr ungestraft bleiben und dass die individuelle strafrechtliche Verantwortlichkeit auch für hochrangige Täter gilt.
Die Weiterentwicklung des Völkerstrafrechts bleibt eine wichtige Aufgabe für die internationale Gemeinschaft. Nur durch eine konsequente Verfolgung der schwersten Verbrechen kann langfristig eine gerechtere und friedlichere Welt geschaffen werden.
„Gerechtigkeit ist eine Voraussetzung für dauerhaften Frieden. Internationale Strafverfolgung kann dazu beitragen, Zyklen der Gewalt zu durchbrechen und den Grundstein für Versöhnung zu legen.“
Das Völkerstrafrecht steht für die Idee, dass bestimmte Verbrechen so schwerwiegend sind, dass sie die internationale Gemeinschaft als Ganzes betreffen und daher auch von dieser Gemeinschaft verfolgt werden müssen. Es ist Ausdruck eines gemeinsamen Werteverständnisses und des Willens, die Menschenrechte weltweit zu schützen.







